Guten Morgen, geneigte Leserin!
Schon lange beschäftigt mich die Frage der vielen Käfige, in denen wir leben. Eigentlich wollte ich einen grösseren Artikel dazu schreiben, aber das Thema wuchs mit jedem Anschlag der Tasten weiter an, sodass ich beschlossen habe, eine kleine Serie von Texten zu diesem Thema zu produzieren. Wir schicken sie Dir jeweils donnerstags, in ein- oder zweiwöchigen Abständen. Sehen wir, wie das zeitlich machbar ist.
Ich freue mich über jeden Kommentar und beantworte grundsätzlich alles. Schreib also, melde Dich, schön, von Dir zu hören!
Markus
Hier Teil 1 der Serie Gestalten in Käfigen.
Das Foto
Vor ein paar Tagen wollte ich im Meyers Konversations-Lexikon Band 6 Elegie–Frankomanie Band 12 Ney-Plünderung etwas zu den Errungenschaften der Fotografie Stand 1877 nachschauen, als aus dem Buch ein grosser Umschlag fiel. Darin ein quadratisches Foto. Es war wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund, der, jahrelang verschollen doch nie vergessen, plötzlich vor der Tür steht und den man sofort wiedererkennt: eines jener Bilder, die einen ein Leben lang begleiten, eine Art Ikone im eigenen Leben, die irgendwie durchgereicht wird durch die Jahrzehnte, die bei allen Umzügen mitkommt und die, als wäre es das Normalste von der Welt, über fünfzig Jahre später aus dem Lexikon, Stichwort Photographie, fallend, sich völlig unverändert wieder präsentiert. Dabei kenne ich das Bild, als hätte ich es erst vor Kurzem in allen Einzelheiten studiert. Als wäre ich selbst der Fotograf gewesen, oder sogar: der Maler, der soeben alle Linien auf dem leicht glänzenden Papier selbst gezogen und die Pigmente sorgfältig mit eigener Hand aufgetragen hat.
Ich stehe auf dem Foto vor einem grossen Rosenstrauch. Ein hoch aufgeschossener, schlaksiger Sechsjähriger, dessen viel zu lange Beine aus einer kurzen Lederhose staksen, hält tapfer seine blaue Schultüte im Arm. Das schräge Licht der Morgensonne tränkt das Ganze in klarer, gelbglänzender Luft. Filme und Fotopapier haben vor einem halben Jahrhundert Farben vollkommen anders dargestellt, als wir das vom heutigen Bildersehen gewohnt sind. Technik und Chemie haben zu jener Zeit eine Art Moll-Filter zwischen Realität und ihrer Darstellung geschoben, der das Farbspektrum aufgebrochen und in abgeschrägter Zusammensetzung wiedergegeben hat. Diese eigene Dramaturgie, mit der die Farbkristalle damals angeordnet wurden, löst heute den Akkord einer glasklaren Erinnerung aus, wie gewisse Gerüche einen mit ungeheuerlicher Präzision an Orte, in Situationen und Begebenheiten zurückwerfen.
Die Luft ist klar, es ist noch kühl an diesem Donnerstagmorgen im Spätsommer oder Frühherbst. Der Duft der Rosenblüten, die sich hinter mir im Morgenlicht öffnen, ist nur zu erahnen. Wie vor allem: Hunden, überhaupt Tieren, dem Nikolaus in der Fussgängerzone, oder Luftballons, die ihr Platzen sozusagen eingebaut haben, habe ich natürlich auch vor diesem ersten Schultag grosse Angst: Der Kindergarten war schon furchterregend genug, jetzt wieder andere fremde Kinder, eine fremde Lehrerin, fremde Regeln und Aufgaben, denen ich vielleicht, oder sicher nicht gewachsen bin. Mein Vater beugt sich über seine Rolleiflex, schaut in den Lichtschacht, in den er die Lupe geklappt hat. Ich sehe das Prisma in der oberen Linse etwas springen, er hat scharf gestellt. Hinter ihm dampft die grosse, taunasse, von Bäumen umgrenzte Wiese des Parkes. Jetzt schaut er, die Morgensonne im Rücken, zu mir auf, ruft, lacht, dann drückt er ab. Fast unhörbar klickt es. Da ist kein Schwingspiegel, an dessen Schlag man das Auslösen hätte identifizieren können, aber wir haben so viele Bilder zusammen gemacht, ich kannte seine Art zu fotografieren: die Kamera mit ihren beiden Augen in seinen grossen Händen seinem tastenden Blick und vor allem dem inneren Auge folgen zu lassen. Kontakt mit dem Subjekt aufzunehmen, und irgendwann unmerklich abzudrücken. Der Moment, in dem er das Foto sah.
Es ist das letzte Bild, das mein Vater von mir gemacht hat. Drei Monate später war er tot. Er muss an diesem Donnerstag Mitte September schon sehr krank gewesen sein, aber, sosehr ich meinen Blick von meinem Rosenbusch aus und an meiner dummen blauen Schultüte vorbei auf ihn anstrenge, war seine Krankheit für den damals Sechsjährigen nicht wahrnehmbar. Eltern sind auf seltsame Weise alterslos für ihre Kinder, als ob das nichts zur Sache täte. Tut es auch nicht. Er war keine dreissig, aber das sagte mir damals nichts.
In den Jahren, die folgten, befand ich mich in einer Art Locked-In-Zustand1. Befand empfinde ich immer als ungelenkes Wort, behördlich. Häufig wird das ohne viel Nachdenken einfach dahergesagt: Sie befand sich zu Hause, als... Es trifft aber mein Dasein der folgenden Jahre genau. Ich lebte nicht in diesem Zustand oder war nicht darin. Ich befand mich darin: Da ist kein äusseres Zutun dabei und kein innerer Antrieb, keine Schuld bei irgendwem und keine Intention. Man findet sich nichteinmal wieder: ich befand mich einfach in diesem grauen Käfig, den irgendeine dunkle Hand zugeworfen und verschlossen hatte. Die farbige Welt irgendwo draussen schien mich nichts anzugehen, sie interessierte mich nicht.
Nichts kommt an dich heran, auch wenn du alles mitbekommst. Ich ging in die Schule, machte keine Hausaufgaben, Unterricht, Spiele und Sport gingen an mir vorbei wie Fremde. Fiel durch, aber das alles hatte nichts mit mir zu tun.
Das Locked-in-Syndrom entsteht meist durch eine Schädigung des Hirnstamms, wobei das Bewusstsein völlig erhalten bleibt. Die Patienten sind bei vollem Verstand, können aber ihren Körper nicht bewegen, meist mit Ausnahme der vertikalen Augenbewegungen und des Lidschlags.
Das Locked-In-Syndrom ist ein einer der erschütterndsten neurologischen Zustände, da der Betroffene bei vollem Bewusstsein eingeschlossen ist in einem Körper, der nicht mehr reagiert. Der Patient ist vollkommen wach. Alle Sinneseindrücke werden wahrgenommen. Die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu verstehen bleibt erhalten, Emotionen werden voll erlebt, Schmerzen werden gespürt.
Ein befreundeter Neurochirurg erzählte mir, dass ihre Pflegemitarbeiter, die Locked-in-Patienten betreuen, wöchentlich geschult werden müssen, um ihnen ständig bewusst zu machen, dass die Patienten, obwohl sie sich nicht bewegen und wie tot in ihren Betten liegen, jedes Wort mitbekommen, verstehen und sich an alles erinnern.
Weitere Informationen zum Locked-In Syndrom




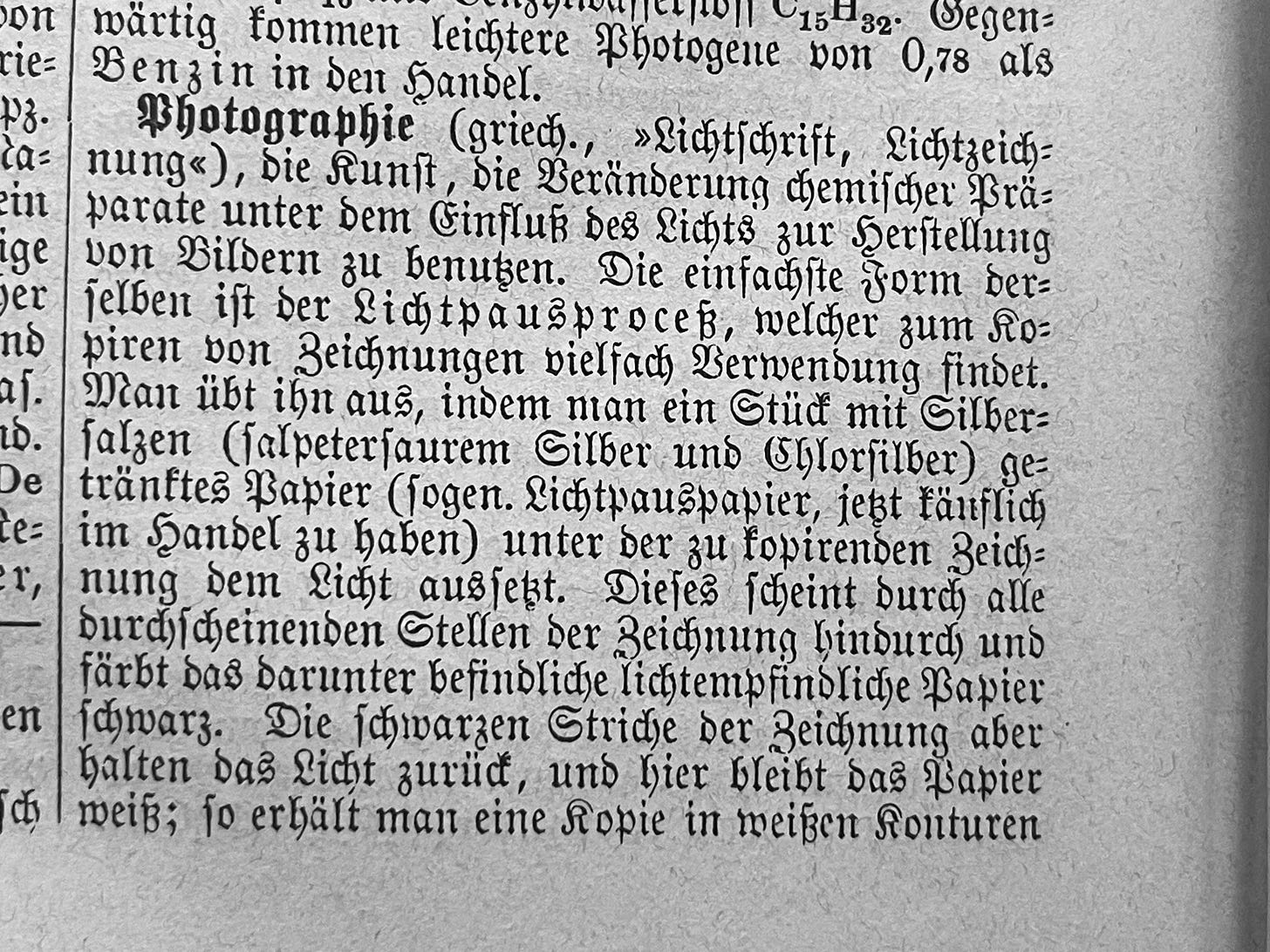
Ich sehe Dein Vater. Ich spüre den ruhigen Rhythmus, und seine Präzision beim vorbereiten des Fotoapparates. Dann fühle ich die Liebe und Wärme zu Dir, er ruft, er lacht. Die Natur, die Luft, die Sonne, ich sehe euch.
Ich bin beeindruckt wie Du Dein Zustand beschreibst. Ein Kind das verstummt, sich nicht mehr spürt, verloren und eingesperrt in ein für Ausserstehende nicht sichtbares Käfig ist.
Lieber Markus, das Thema Gestalten in Käfigen ist gewaltig. Gleich fühlt sich das Innerste angesprochen. Als erstes kommt ein Gedicht:"Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt."
Dann beschreibst du in wunderbar poetischer Sprache die Extremform des Käfigs: das Locked In Syndrom. Du beschreibst es meisterhaft, das kann ich sagen, weil ich es kenne. Aus der Kindheit und auch aus späteren Zeiten. Ich dachte damals, die Untoten würden sich so fühlen. Aus merkwürdigen, eigenartigen, mich sehr bewegenden aber unverständlichen Erlebnissen formte sich schließlich eine Evidenz wie ein Blitz aus dem Unbewussten: Ich wollte meinem Vater in den Tod folgen. Ich schaffte es offenbar bis in dieses Zwischenreich.